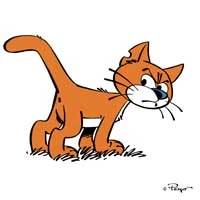Man muss schon eine besondere Form des moralischen Gedächtnisverlusts kultiviert haben, um nach zehn Jahren Schutzgewährung, nach tausenden geretteten Familien, nach einer halben Million Kindern, die heute Lesen, Schreiben und Träumen können, ernsthaft zu fragen, was wir denn eigentlich geschafft haben. Man muss sich mit geradezu akrobatischer Verbohrtheit weigern, die vielleicht schlichteste Wahrheit des politischen Handelns zur Kenntnis zu nehmen: dass das Rettende nicht in der Kassenbilanz aufgeführt wird, sondern im Leben, das stattgefunden hat, weil wir es zugelassen – nein: ermöglicht – haben.
Wer Menschlichkeit verrechnen will, hat sie nie verstanden.
Doch kaum war der Satz „Wir schaffen das“ ausgesprochen, begann eine nationale Rechenübung, als hätte Frau Merkel den Bau eines Freizeitbades angekündigt und nicht die Entscheidung getroffen, Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz zu bewahren. Da wurde gezählt, verglichen, gewogen, so als gäbe es am Ende ein Soll und Haben der Menschlichkeit. Wie viele sind in Arbeit, wie viele sprechen Deutsch, wie viele kosten noch – das sind die Fragen, mit denen sich diejenigen beruhigen, deren Mitgefühl exakt so weit reicht wie der nächste Stammtisch.
Überforderung? Nein. Nur die Überforderung eurer Empathielosigkeit.
Man hörte den Begriff „Überforderung“ bald häufiger als den Begriff „Menschenwürde“, und wer das Leid sah und den Blick nicht abwenden wollte, wurde mit kühler Arroganz der „naiven Gutmütigkeit“ bezichtigt – ein Vorwurf, der inzwischen als letzter Notnagel dafür herhalten muss, den eigenen Empathiemangel in intellektuelle Kritik umzuwandeln.
Eine halbe Million Kinder schreibt ihre Zukunft auf Deutsch – und ihr zählt immer noch Quittungen
Es ist verräterisch, dass das größte Argument gegen „Wir schaffen das“ nicht etwa ein Scheitern war, sondern der schiere Umstand, dass es gelungen ist. Denn wer darauf besteht, dass Menschlichkeit an irgendeiner Grenze enden müsse, empfindet jeden Beweis des Gegenteils als Zumutung. Wenn Kinder aus Aleppo heute in deutschen Klassenzimmern sitzen und eine Zukunft aufbauen, dann wird das nicht etwa als Erfolg gesehen, sondern als störende Erinnerung daran, dass man selbst hätte handeln können, aber lieber in der Komfortzone des misstrauischen Zauderns verharrt ist.
Das wahre Versagen: Dass manche lieber Grenzen ziehen als Leben retten.
Am Ende bleibt nicht die Frage „Was hat es uns gebracht?“, sondern die viel wichtigere: Was sagt es über uns, dass wir diese Frage überhaupt stellen? Vielleicht sollten wir uns weniger mit Prozentsätzen und Haushaltszahlen beschäftigen und stattdessen mit der unerhörten Tatsache, dass Mitgefühl keine Rechenaufgabe ist, sondern der einzige Bereich politischen Handelns, der seinen Sinn nicht in sich selbst trägt, sondern im Leben anderer. Und vielleicht erschreckt genau das manche so sehr, dass sie bis heute nicht sagen können: Ja – wir haben es geschafft. Und es war richtig so.