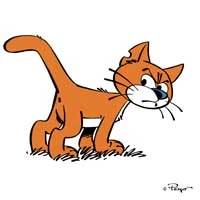Bei den Diskussionen über Flüchtlinge vermisse ich Beiträge von ehemaligen DDR-Bürgern, die 1989 über Ungarn in den Westen geflohen sind.
Es war kein Krieg, es gab keinen Hunger. Aber für die Befriedigung ihrer Sehnsucht nach Reisen in ferne Länder und große Autos nahmen Familien samt Kleinkindern große Strapazen auf sich, um in ein gelobtes Land zu kommen.
Diese Leute müssten die Flüchtlinge doch am besten verstehen.
„Wirtschaftsflucht statt Realitätsflucht“ – so könnte man pointiert beschreiben, was viele Ostdeutsche 1989 betrieb, als sie über Ungarn den Sprung in die Bundesrepublik wagten. Sie verließen keine Trümmerlandschaft, sie flohen nicht aus zerbombten Städten und auch nicht aus einem Land ohne Brot. Im Gegenteil: Sie hatten Wohnungen, Arbeit, Krankenversorgung. Doch was fehlte, war die Freiheit, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Verlockung offener Grenzen, besserer Konsummöglichkeiten und individueller Selbstbestimmung war stärker als die Bequemlichkeit des gesicherten Alltags in der DDR.
Heute wird über Geflüchtete häufig mit der strikten Trennung argumentiert: „echte“ Flüchtlinge, verfolgt oder aus Kriegsgebieten, im Gegensatz zu „Wirtschaftsflüchtlingen“, die bessere Chancen für sich und ihre Kinder suchen. Genau an dieser Stelle könnte das Zeugnis der DDR-Flüchtlinge eine wertvolle Stimme sein. Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass Lebensqualität mehr ist als das nackte Überleben. Sie wissen, wie stark die Sehnsucht nach Teilhabe an Freiheit, Mobilität und Wohlstand sein kann – und dass Menschen bereit sind, dafür große Hürden zu überwinden. Wer 1989 im Westen willkommen war, obwohl er nicht körperlich bedroht war, sollte heute Verständnis für jene aufbringen, die ebenfalls in Hoffnung auf ein besseres Leben Grenzen überschreiten.